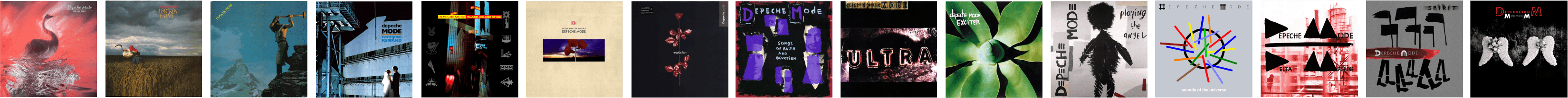|
Nennen Sie es Galgenhumor
Dave Gahan (07.12.2012)
Wenn man schon mal klinisch tot war, sieht man die Dinge gelassener. Der Depeche-Mode-S├żnger Dave Gahan ├╝ber die Lehren aus einem dunklen Moment in seinem Leben, Auftritte in Diktaturen und seine Jugend als Punk.
Kitschige ├¢lgem├żlde in barocken Goldrahmen, schwere Teppiche, verschn├Črkelt bemalte Porzellan-Lampen ŌĆō und mittendrin sitzt Dave Gahan. Als S├żnger von Depeche Mode ist er eine der bekanntesten und schillerndsten Figuren der j├╝ngeren Popgeschichte, im Zimmer dieses Pariser Luxushotels wirkt er etwas deplatziert: grau melierter Stoppelbart, klobige Ringe an den H├żnden, schwarze Weste ├╝ber schiefem Unterhemd, dazu schwarzes Jackett und schwarze Jeans. Sogar die Haare sind noch tiefschwarz, er tr├żgt sie wieder nackenfrei und gegelt wie in den 80er-Jahren, als Millionen Elektro-Fans so aussehen wollten wie er und ihn nachahmten. Jetzt haben Depeche Mode hier in Paris eine neue Welttournee f├╝r 2013 angek├╝ndigt und nehmen sich Zeit f├╝r Interviews nahe den Champs-├ēlys├®es. Gahan, dessen Gesichts- und Augenfalten seine nun auch schon 50 Jahre verraten, hat gute Laune ŌĆō obwohl er die ganze Zeit im Hotel sitzen muss. ŌĆ×Jetzt sind wir schon in Paris und kommen kaum vor die T├╝rŌĆ£, brummelt er grinsend, ŌĆ×aber hey: Wir sind immerhin in Paris!ŌĆ£
Mr. Gahan, Sie treten mit Depeche Mode demn├żchst an Orten auf, die von internationalen Pop-Stars nur selten bespielt, meistens ganz gemieden werden: Sofia, Kiew, Bratislava, Minsk oder Zagreb beispielsweise. Was reizt Sie daran?
Wir wollten von Anfang an zwei Dinge: die Welt sehen und ├╝berall dort spielen, wo uns Leute h├Čren wollten. Selbst als diese Orte noch hinter dem Eisernen Vorhang lagen, sind wir dorthin gefahren. Das lie├¤ sich in unserem Job meistens gut verbinden.
Auftakt der neuen Tour ist ausgerechnet in Tel Aviv. 2006 mussten Sie Ihr Konzert dort wegen des Libanonkrieges absagen ŌĆ”
Ja, das haben wir sehr bedauert. Das geschah, als bereits das Ende der Tour in Sicht war. Jeder von uns war m├╝de, aber es stand noch die Show in Tel Aviv an. Als wir in der T├╝rkei waren, wurde berichtet, dass Raketen auf Tel Aviv abgefeuert wurden. Dennoch waren wir als Band entschlossen, dort aufzutreten.
Hatten Sie keine Angst?
Nein, wir selbst waren nicht um unsere pers├Čnliche Sicherheit besorgt. Aber es ging ja nicht nur um uns. Wir waren ja auch f├╝r die 50.000 Menschen in dem gro├¤en, offenen Park verantwortlich, in dem wir spielen sollten. Da wurden dann die unterschiedlichen Bedrohungsszenarien durchgespielt: Was w├żre, wenn sich ein Terrorist unter die Zuschauer mischte und wom├Čglich eine Bombe z├╝ndete? Au├¤erdem hatte uns die H├żlfte unserer Crew unmissverst├żndlich klargemacht: ŌĆ×Ihr k├Čnnt uns feuern, aber wir fahren da nicht hin.ŌĆ£ Also sagten wir ab, obwohl wir viele Fans in Israel damit ma├¤los entt├żuschten. Wir bekamen daraufhin Tausende tieftraurige, herzzerrei├¤ende Mails und Briefe. Die Leute hatten sich gerade wegen der angespannten Lage auf unser Konzert gefreut. Es ging damals nicht anders. Wir sind dann bei der n├żchsten Tournee 2009 dort aufgetreten.
In den 80er-Jahren durften Depeche Mode als eine der wenigen westlichen Bands viele Konzerte in damaligen Ostblock-L├żndern wie Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei und der DDR spielen. Wie schwierig war es, als Westband dort aufzutreten?
Es gab jede Menge H├╝rden, die man ├╝berwinden musste. Die erste war: Man musste ├╝berhaupt erst einmal reingelassen werden hinter den Eisernen Vorhang. Wir mussten unser Management immer wieder fragen: K├Čnnen wir in Polen spielen? K├Čnnen wir in Ost-Berlin spielen? Unsere Agenten fragten dort immer wieder an ŌĆō und wenn sie irgendwann eine Einladung bekommen hatten, sagten wir meistens sofort zu. F├╝r uns war das auch ein kleines, reizvolles Abenteuer ŌĆō keine andere westliche Band fuhr da hin! Denn den meisten waren diese L├żnder v├Čllig egal. Au├¤erdem konnte man mit den Konzerten im Osten kein Geld verdienen: Polnische Zloty oder tschechische Kronen konntest du ja nicht umtauschen, wir konnten also nicht mal unsere Produktionskosten decken. Die waren damals aber auch noch nicht ann├żhernd so hoch wie heute. Wir waren einfach neugierige, junge Burschen, die darauf brannten; die ├╝berall auftreten wollten. Die Leute wollten uns h├Čren ŌĆō also fuhren wir hin.
Ihr Bandkollege Martin Gore lebte von 1985 bis 1987 mit seiner deutschen Freundin sogar in West-Berlin, nahe der Mauer. Sie nahmen im Hansa-Studio Ihre Alben ŌĆ×Some Great RewardŌĆ£ und ŌĆ×Black CelebrationŌĆ£ auf. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit, als Berlin noch Grenzstadt war und keine Schnittstelle zwischen Ost und West?
Wann immer ich in den letzten Jahren in Berlin war, dachte ich: Unfassbar, wie sich die Stadt seitdem ver├żndert hat und st├żndig weiter ver├żndert. West-Berlin war damals eine kleine Insel. Fast wie das Greenwich Village in New York, wo ich heute lebe: ganz anders als der Rest des Landes. So war Berlin auch offener, kreativer, aufregender, gro├¤st├żdtischer, multikultureller als der Rest von Deutschland. Die Zeit, als wir in den Hansa-Studios direkt an der Mauer arbeiteten, hat sich mir ins Ged├żchtnis gebrannt. Ich wei├¤ noch, wie wir aus dem Mix-Raum guckten ŌĆō und fast direkt auf die Wachposten blickten. Unheimlich, sich das heute vorzustellen.
Am 7. M├żrz 1988 gaben Depeche Mode ein inzwischen legend├żres Konzert in der Ost-Berliner Werner-Seelenbinder-Halle in Prenzlauer Berg. War das, abgesehen von der Neugier, die Sie zu solchen Grenz├╝berschreitungen antrieb, ein politisches Statement?
Nein. Die politischen Deutungen unserer Auftritte interessierten uns kaum. Wir waren jung, freuten uns dar├╝ber, dass wir auch in der DDR ein riesiges Publikum hatten. Wir dachten nicht in Kategorien wie: Ist das jetzt richtig oder falsch, anbiedernd oder rebellisch? Im Grunde stellten wir uns immer wieder dieselben Fragen: K├Čnnen wir da hinfahren? K├Čnnen wir da auftreten? Und wenn unser Manager meinte ŌĆ×k├Čnnte klappenŌĆ£, jubelten wir: ŌĆ×Auf gehtŌĆÖs!ŌĆ£
Ihr Bandkollege Andy Fletcher sieht das etwas kritischer. Er sagte uns, Depeche Mode seien ├Čfter von den Regimes f├╝r deren Zwecke eingespannt worden.
Das ist verzwickt. Einerseits stimmt das. Auch bei unseren Konzerten in der DDR wurden wir wohl von der Partei ausgenutzt ŌĆō allein schon in dem Sinne, dass sie sich selbst als modern darstellen konnten, nur weil sie uns auftreten lie├¤en. So gaben sie sich ├╝brigens auch uns gegen├╝ber. Auch wenn wir nach Polen oder Tschechien kamen, wurden wir dort von den Veranstaltern und Sicherheitsleuten unglaublich hofiert.
Aber ist so was bei Rockstars nicht gang und g├żbe?
Das hatte noch mal eine andere Dimension. Die Verantwortlichen in den Ostblock-L├żndern legten sich auf sehr ├╝bertriebene Art ins Zeug, wohl, um uns zu beweisen, wie gut und normal das Leben in ihren L├żndern doch sei. Wir wurden beispielsweise in dekadente Hotels gesteckt und dort sagte man uns st├żndig: ŌĆ×Seht her, auch wir haben ŌĆō Eier! Wir haben alles, was Ihr aus dem Westen kennt!ŌĆ£ Aber wir waren ja nicht bl├Čd. Wir wussten nat├╝rlich, dass es den Menschen au├¤erhalb des Hotels nicht ann├żhernd so gut ging wie uns da drinnen.
Sie bereuen also nicht, dort aufgetreten zu sein?
Wir waren getrieben von der Idee, dass Musik keine Grenzen, keine Teilung kennt. Wir fanden und finden nach wie vor, Musik darf nicht zensiert werden. Man darf niemandem verbieten, diese oder jene Musik zu h├Čren, weil sie als subversiv gilt. Auch das haben wir erlebt. Wir d├╝rfen beispielsweise bis heute nicht in China auftreten, weil bestimmten Moralw├żchtern Inhalte unserer Songs nicht passen. Erst vor ein paar Jahren haben sie noch alle unsere Texte kontrolliert ŌĆō und uns dann abgelehnt.
Welche Lieder waren den Chinesen denn zu subversiv ŌĆō ŌĆ×People are PeopleŌĆ£?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich sch├żtze, Sie sahen in uns vor allem Botschafter des freien Westens. Sie f├╝rchteten offenbar, dass schon die Konzerte wie eine Art Werbung f├╝r westliche Werte wirken. Obwohl wir uns selbst nie in dieser Rolle gesehen haben. F├╝r die Jugend in all diesen L├żndern stand Depeche Mode sicher auch f├╝r Werte wie pers├Čnliche Freiheit, Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst, ohne dass wir das explizit in unseren Songs ausgesprochen h├żtten. Vielleicht haben wir diese Jugend durch unsere Auftritte ein bisschen inspiriert oder ermutigt. Manchmal f├╝hlte es sich so an.
Woran machen Sie das fest?
Als wir beispielsweise 1988 zum ersten Mal in Ost-Berlin die B├╝hne betraten, lag etwas in der Luft. Wir konnten einen Freiheitsdrang, eine besondere Euphorie sp├╝ren, die von den Leuten im Publikum ausging. Man konnte dieses Gef├╝hl fast mit den H├żnden greifen. Dieser Tag, die Tatsache, dass wir dort spielten, war etwas Besonderes f├╝r die Zuschauer dort. Und f├╝r uns hat sich das genauso angef├╝hlt. Manchmal sp├╝rten wir jedoch bei unseren Konzerten im Ostblock genau entgegengesetzte Gef├╝hle ŌĆō eine Angespanntheit und Angst. Das sp├╝re ich auch heute noch manchmal, wenn wir in Krisengebieten auftreten. Wenn sich beispielsweise Songs verselbstst├żndigen. Je nachdem, wo wir auftreten, k├Čnnen sie ganz anders gedeutet werden. ŌĆ×Walking In My ShoesŌĆ£ wurde vor der politischen Wende von vielen Zuschauern in Osteuropa wie eine Art Volkslied gefeiert. Alle singen mit: ŌĆ×Ich w├╝rde dir von all dem erz├żhlen, was sie mir angetan haben / all dem Schmerz, dem man mich aussetzte ŌĆ” Bevor du deine Schl├╝sse ziehst, versuch einmal dich in meine Lage zu versetzen.ŌĆ£ Wenn das Zehntausende mit unglaublicher Inbrunst mitsingen, ist es, als w├╝rde ihnen der Song aus der Seele sprechen.
Vielleicht wird das am Ende Ihrer Tournee wieder genauso sein, dann spielen Sie erstmals in Minsk, in Wei├¤russland ŌĆ”
Wieder so ein Ort, an dem vor uns noch keine westliche Band spielte.
Aus gutem Grund: Das Land gilt als letzte Diktatur Europas. Menschenrechtsorganisationen fordern, solche Staaten zu boykottieren und nicht dort aufzutreten.
Unser Weg ist heute der gleiche wie damals. Wir wollen auch in solche L├żnder fahren, um die Menschen dort zusammenzubringen. Wenn wir in Minsk spielen, werden im Stadion Leute aus allen politischen Lagern sein. Aber in unserem Konzert sind sie vereint.
K├Čnnen Sie sich vorstellen, dann Ihre privilegierte Position zu nutzen, indem Sie beispielsweise die Internetzensur des wei├¤russischen Diktators Lukaschenko kritisieren?
Gew├Čhnlich sage ich schon ein paar S├żtze zu der Situation vor Ort. Nur will ich damit keinen Spalt durchs Publikum treiben. Ich will so ein Konzert nicht anders aufbauen, nur weil es in Minsk und nicht in Berlin oder Kalifornien stattfindet. Ich sehe eher das Einende: Auch in Wei├¤russland gibt es Menschen, die seit Jahren unsere Musik h├Čren. Das verbindet sie mit uns und mit dem Rest der Welt. Und diese Verbindung will ich nicht zerst├Čren. Ich will auf der B├╝hne keine Politik predigen, das ist Bonos Job.
Der brachte im Umfeld eines U2-Konzertes in Moskau das Kunstst├╝ck fertig, kurz vorher medienwirksam mit Pr├żsident Dmitri Medwedew Tee zu trinken, um ├╝ber Afrikahilfe zu sprechen ŌĆō und sp├żter beim Konzert holte er dann den Dissidenten-Rocker Juri Schewtschuk auf die B├╝hne.
Bono checkt in jeder Stadt vorher die Nachrichtenlage, l├żsst sich briefen, um dann detailliert Stellung beziehen zu k├Čnnen. Er ist darin auch richtig gut. Aber ich mache sowas nicht.
Depeche Mode haben auch schon in Moskau gespielt und treten dort 2013 wieder auf. Nur einmal angenommen, kurz bevor Sie da auftreten, h├żtte das Verfahren gegen die M├żdchen-Punkband Pussy Riot stattgefunden. Wie w├żren Sie damit umgegangen?
Ich habe gesehen, dass andere Musiker das Urteil kommentiert haben oder Protest-Shirts auf der B├╝hne trugen. Das kann man alles machen. Aber es ist nicht meine Art, mich auszudr├╝cken. Dass wir uns nicht missverstehen: Ich bin gegen jede Form von Zensur und Einschr├żnkung der freien Meinungs├żu├¤erung. Meinungsfreiheit sollte so selbstverst├żndlich sein wie die Luft, die wir atmen. Und was Pussy Riot taten, als sie in der Christ-Erl├Čser-Kathedrale in Moskau gegen Pr├żsident Putin protestierten, war einfach freie Meinungs├żu├¤erung. M├Čglicherweise war der Ort, den sie w├żhlten, um ihre Meinung zu ├żu├¤ern, etwas kontrovers. Immerhin ist die Kirche in Russland ein Hort der Tradition.
Sie k├Čnnen sich also in jene Menschen hineinversetzen, die durch den Protest in der Kathedrale ihre religi├Čsen Gef├╝hle verletzt sahen?
Das kann ich eben nicht. Weil ich nicht religi├Čs bin.
Ihre Texte legen etwas anderes nahe: Sie singen ├╝ber ŌĆ×The Sinner in MeŌĆ£ und ŌĆ×The Presence Of GodŌĆ£, ├╝ber den ŌĆ×Personal JesusŌĆ£ ŌĆō und immer wieder auch ├╝ber Engel und Teufel.
Aber da geht es nicht um Religion, sondern um Spiritualit├żt. Gro├¤er Unterschied. Ein Teil des Universums sein zu wollen oder die Verbindung zu der Kraft zu f├╝hlen, die da drau├¤en ist ŌĆō das hat f├╝r mich nichts mit Religion zu tun.
Klingt esoterisch.
Gar nicht. Wir verschwenden doch immer noch zu viel Zeit darauf, uns durch Religionen voneinander unterscheiden zu wollen. Aber wie kann es darauf ankommen, auf welche Art und Weise man glaubt? Falls es einen Gott gibt, dann ist es doch immer nur dieser eine, oder? Es gibt nicht zehn, die sich in einem Komitee beraten m├╝ssen. Und dieser eine Gott st├Črt sich ganz sicher nicht an einer kleinen Punkband, die in Russland in einer Kathedrale auftritt.
Eine wilde Zeit. Ich erinnere mich sehr gut daran, sie pr├żgt mich bis heute. Ich war praktisch ohne Vater aufgewachsen; um an etwas Geld zu kommen, verh├Čkerten meine Freunde und ich sogar mal Hehlerware und landeten kurz im Jugendarrest. Ich verlie├¤ schon mit 15 Jahren die Schule, aber es gab keinerlei Jobs. Der M├╝ll t├╝rmte sich am Stra├¤enrand, weil es immer wieder Streiks gab. Jeder streikte. Die M├╝llabfuhr, die Bergarbeiter, jeder. Unsere Lehrer sagten uns immer wieder: Aus Euch wird niemals etwas werden. So kam ich dann zum Punk.
Was hat Sie daran angesprochen?
Pl├Čtzlich waren da diese irren Typen in all diesen Bands, die genau waren wie wir. Als ich 14 war, war Punkrock das Erste, zu dem ich eine echte Verbindung aufbauen konnte. Die Sex Pistols sprachen endlich eine Sprache, die ich verstehen konnte.
Umso ├╝berraschender, dass Sie nur drei Jahre sp├żter Depeche Mode mitgr├╝ndeten und dann d├╝steren Elektro-Pop auf Synthesizern und Drumcomputern spielten ŌĆō eine komplett andere Musik als der Gitarrenl├żrm der Punk-Bands. Was hat diese Metamorphose bei Ihnen eingeleitet?
Es gab auch bei Depeche Mode immer noch eine Verbindung zum Punk. Klar, The Clash waren politischer, die Sex Pistols provokanter, ihre Musik wurzelte im Rock ŌĆÖnŌĆÖ Roll. Aber schon Siouxsie And The Banshees, die ich verehrte, sangen viel abstrakter, kunstvoller ├╝ber Frustration. K├żlter und dunkler. Mit Depeche Mode stiegen gegen Ende der Punkbewegung neue Bands aus dem Untergrund auf: The Cure, Echo And The Bunnymen, Joy Division, New Order ŌĆ” Sie alle w├╝rden die Sex Pistols und The Clash als ihre Initialz├╝ndung nennen, da bin ich sicher. Auch wenn Depeche Mode ein anderes Musikgenre schufen, hatten wir doch die wesentliche Idee des Punk verinnerlicht: dass du kein gro├¤er Musiker sein musst, um gro├¤artige Songs schreiben zu k├Čnnen. Wir konnten einfach mit zwei Fingern auf dem Synthesizer spielen, die Drum-Maschine anwerfen, die Technik einst├Čpseln und unsere kurzen Drei-, Vier-Minuten-Songs spielen. Unser Credo war: Wir k├Čnnen machen, was wir wollen! Wir brauchen kein teures Equipment, wir schreiben einfach unsere Songs. Und jedem, der an uns zweifelte, schrien wir entgegen: ŌĆ×Wir k├Čnnen das sehr wohl!ŌĆ£
Nur klangen Sie melancholisch und k├╝hl.
Nein, in unseren fr├╝hen Jahren waren wir laut und schnell. Wir drehten die Drum-Maschine voll auf und legten los. Wir waren wie elektronische Ramones! Und wir waren nie so wie all jene 80er-Bands, die die 80er nicht ├╝berlebten, wie Duran Duran oder Spandau Ballett. Wir drehten keine Videos in Sri Lanka auf einem wei├¤en Boot, wir drehten in Berlin, in einem Abbruchgeb├żude, in dem wir Autos zertr├╝mmerten. Unser Sound war hart und kalt, die Instrumentierung manchmal brutal. Das Besondere war aber, dass im Zentrum der Lieder immer Melodie, Gef├╝hle, Emotionen und Ehrlichkeit standen. Und das funktioniert bis heute.
Ihre Alben verkaufen sich nach wie vor millionenfach, aber die Kritiker m├żkeln, mit Depeche Mode sei es nicht anders als mit den Rolling Stones: Es gibt immer noch neue Songs, die aber nie mehr an die Klassiker heranreichen. Trifft Sie das?
Nat├╝rlich schmerzen solche Kritiken. Wenn du Songs schreibst, auf die du stolz bist, und Kritiker maulen: ŌĆ×Damit kann ich nichts anfangen.ŌĆ£ Das verletzt mich, klar. Aber nach 30 Jahren gibt es eben auch Leute, die dich von fr├╝her kennen und dich damals vielleicht mehr mochten als heute. Und wenn sie uns jetzt schlecht finden, nun, dann m├╝ssen sie heute wohl anderen Bands den Vorzug geben.
├£berlegen Sie manchmal, ob an der Kritik etwas dran sein k├Čnnte? Zum Beispiel ist von The Cure seit Jahren nichts Neues erschienen. Deren Bandleader Robert Smith hat das einmal damit erkl├żrt, dass er nur gute Songs schreiben k├Čnne, wenn er so richtig ungl├╝cklich sei. Inzwischen gehe es ihm einfach zu gut. Sie dagegen singen noch immer, ŌĆ×We are damaged people, disturbed soulsŌĆ£, besch├żdigte Menschen, verst├Črte Seelen ŌĆō obwohl Sie heute Million├żre und Familienv├żter mittleren Alters sind.
Klar, wir sind heute gl├╝ckliche Menschen. Aber jeder schwingt eben auch vor und zur├╝ck. Ich habe Momente, in denen ich mich in einen finsteren Winkel versetzt f├╝hle. Heute kann ich mich bewusst entscheiden, dann nicht in Depressionen zu verfallen. Aber ich kenne diese Stimmung sehr gut, die unsere Songs beschreiben. Heute gehe ich raus, laufe etwas durch New York, umgebe mich mit Menschen. Das ist das Gute an New York: Du kannst herumlaufen und trotzdem auf gewisse Weise isoliert sein. Aber in all diesen Stimmungen schreibe ich Songs. Ich beschreibe meine Gedanken ├╝ber Vergangenes oder ├╝ber eine Beziehung zu mir oder einer anderen Person ŌĆō oder der Welt. Ich will geh├Črt, ich will verstanden werden, das treibt mich an.
Aber vielleicht wirkt ein Song dr├żngender, wenn man gerade wirklich am Leben leidet, wie Sie vor 15 Jahren, als Sie Ihre Drogensucht therapieren mussten und fast gestorben w├żren.
Erfolg hat einen Vorteil: Ich kann es mir heute leisten, ein K├╝nstler zu sein, muss mir keine Sorgen ├╝bers Geld machen oder wie ich die Studiengeb├╝hren meiner Kinder zahlen soll. Aber dass dieses neue Lebensgef├╝hl unsere Musik ver├żndert hat, glaube ich nicht. Denn ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Ich lebe in dem Gef├╝hl, dass ich alles so schnell wieder verlieren kann, wie es mir gegeben wurde.
Mr. Gahan, Deutschland ist eine der unbestrittenen Hochburgen von Depeche Mode. Einer Ihrer Bandkollegen erkl├żrte das damit, dass Sie ├╝ber Gef├╝hle singen und dazu Maschinenmusik spielen ŌĆō ŌĆ×Sowas m├Čgen Deutsche eben.ŌĆ£ Allein dieser Satz zeigt, was viele an Depeche Mode ├╝bersehen: Ihre Selbstironie und Ihren Humor.
Endlich sagt es mal jemand.
Ihre Texten sind voller selbstironischer Andeutungen, nach Ihrer ├Čffentlich durchlittenen Drogenkrise schrieben Sie Songs wie ŌĆ×Suffer WellŌĆ£, leide sch├Čn. Auf einem der k├żuflichen Tour-Shirts von Depeche Mode stand einmal ŌĆ×Pain and suffering in various temposŌĆ£, Schmerz und Leiden in verschiedenen Geschwindigkeiten. F├╝hlen Sie sich manchmal sogar zu ernst genommen?
Also, zuerst muss ich betonen, dass wir unsere Musik sehr, sehr ernst nehmen. Aber wir sind nun mal Engl├żnder. Sarkasmus, einander veralbern, das geh├Črt zu unserer Natur. Wir tun das im Studio, hinter der B├╝hne, wenn wir Musik machen.
├£ber Ihre Lebenskrise in den 90er-Jahren ist viel ├Čffentlich geworden: wie Sie mit Ihrer Drogensucht k├żmpften, einen Suizidversuch begingen, sich zweimal scheiden lie├¤en, 1996 nach einer ├£berdosis Heroin schon klinisch tot waren und nur knapp gerettet wurden. Holt Sie diese Zeit manchmal noch ein?
Ich bin mit mir im Reinen. Ich bin durch diese H├Člle gegangen, und tats├żchlich versetzen mich einige unserer Songs mental noch immer in diese Zeit zur├╝ck, wenn wir sie spielen. Aber heute wei├¤ ich, wie ich da hineingeraten bin und kann rechtzeitig die Bremsen ziehen. Ich sehe es als Warnung an mich selbst.
Als Gasts├żnger und Texter des englischen Musikprojekts The Soulsavers haben Sie deren neue CD ŌĆ×The Light the Dead seeŌĆ£: Das Licht, das die Toten sehen. Ein Kommentar zur gro├¤en Medien-Aufmerksamkeit f├╝r Ihre eigene Wiederkehr von den Toten?
Nennen Sie es Galgenhumor. Ich mag solche Poesie: d├╝ster, aber zugleich humorvoll in ihrer Dunkelheit. So wie die Geschichten von Edgar Allan Poe ŌĆō abgedreht und wahrscheinlich im Opium- und Alkohol-Rausch entstanden, aber auf ihre Art witzig. Das liebe ich. Du brauchst immer Humor im Leben. So schwer, wie es manchmal ist, w├╝rden wir sonst alle nur in der Ecke sitzen und heulen.
Das Interview f├╝hrte Steven Geyer
|
































 ), ą▓čŗ ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ ą▓ čÄąĮąŠčüčéąĖ čüąŠą▓ąĄčĆčłą░ą╗ąĖ ą║ą░ą║ąĖąĄ-ąĮąĖą▒čāą┤čī ą┐ąŠčüčéčāą┐ą║ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĄ čüčéą░ą╗ąĖ ą▒čŗ čüąŠą▓ąĄčĆčłą░čéčī čüąĄą╣čćą░čü? ąŁč鹊 ąČąĄ ąĮąĄ ąĘąĮą░čćąĖčé, čćč鹊 ą▓čŗ čüąĄą▒čÅ ą┐čĆąĄąĘąĖčĆą░ąĄč鹥. ąÆ 5 ą╗ąĄčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓čŗ ą┤ą╗čÅ ą│ąŠčüč鹥ą╣ čćąĖčéą░ą╗ąĖ čüčéąĖčłąŠą║ ą┐čĆąŠ ą▒čŗčćą║ą░, čüč鹊čÅ ąĮą░ čéą░ą▒čāčĆąĄčéą║ąĄ. ąĪąĄą╣čćą░čü čŹč鹊 č鹊ąČąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī, ąĮąŠ ąĮąĖ ą║ č湥ą╝čā.
), ą▓čŗ ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ ą▓ čÄąĮąŠčüčéąĖ čüąŠą▓ąĄčĆčłą░ą╗ąĖ ą║ą░ą║ąĖąĄ-ąĮąĖą▒čāą┤čī ą┐ąŠčüčéčāą┐ą║ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĄ čüčéą░ą╗ąĖ ą▒čŗ čüąŠą▓ąĄčĆčłą░čéčī čüąĄą╣čćą░čü? ąŁč鹊 ąČąĄ ąĮąĄ ąĘąĮą░čćąĖčé, čćč鹊 ą▓čŗ čüąĄą▒čÅ ą┐čĆąĄąĘąĖčĆą░ąĄč鹥. ąÆ 5 ą╗ąĄčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓čŗ ą┤ą╗čÅ ą│ąŠčüč鹥ą╣ čćąĖčéą░ą╗ąĖ čüčéąĖčłąŠą║ ą┐čĆąŠ ą▒čŗčćą║ą░, čüč鹊čÅ ąĮą░ čéą░ą▒čāčĆąĄčéą║ąĄ. ąĪąĄą╣čćą░čü čŹč鹊 č鹊ąČąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī, ąĮąŠ ąĮąĖ ą║ č湥ą╝čā.
 "
"